Meine Leseecke - hier könnt ihr schmökern

Größere Projekte
Luzie steht im Wald - ein Adventsroman

Luzie hat von ihren Freundinnen und Kollegen eine Auszeit in einer Hütte im Wald geschenkt bekommen, um ihren ersten Urlaub seit langem dort zu genießen.
Doch des romantische Häuschen im Wald liegt nicht nur ruhig, sondern einsam, zum Heizen und Kochen dient ein Holzofen und ein richtiges Bad gibt es auch nicht, von Handynetz oder Internet ganz zu schweigen. So verbringt Luzie ihre Adventszeit ganz anders als gedacht...
*
Mit ein paar Seiten Geschichte und einer hübschen Illustration für jeden Tag vom 1. bis zum 24. Dezember soll dieses Büchlein ein Adventskalender für Erwachsene sein - ohne Schokolade, aber mit viel Herz und Ideen für eine geruhsame Adventszeit.
Text und Bilder sind fertig - wer weiß, vielleicht finde ich einen Verlag dafür. Wenn nicht, finde ich schon einen anderen Weg, dieses Projekt unter die Leute zu bringen.
Die Große Kälte
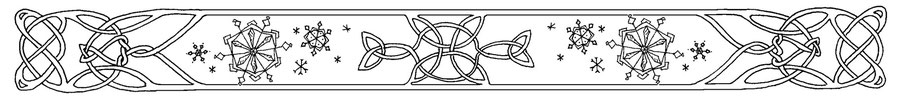
Die Große Kälte - das ist ein Romanprojekt, an dem ich seit über zehn Jahren arbeite. Inzwischen hat es das Ausmaß einer umfangreichen, teilweise illustrierten Trilogie erreicht. Gerade schreibe ich an den letzten Kapitel. Dann kommt eine Überarbeitung von Anfang an und vielleicht bin ich irgendwann ja damit fertig (und zufrieden).
Demnächst könnt ihr hier ein bisschen hineinschnuppern in dieses Projekt.
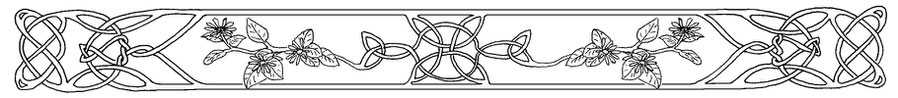
kürzere Texte
Jahreszwielicht
Es gibt viele malerische Begriffe in unserer Sprache. Dafür – so meine ich gelesen zu haben – ist das Deutsche recht bekannt, als Sprache der Dichter und Denker. Zumindest früher einmal.
Wie auch immer, auf jeden Fall haben wir Wörter für wahrlich seltsame Dinge.
Wenn ich in diesem Zwielicht des Jahres zwischen dem letzten Herbstlaub und dem ersten Wintergrau durch die Welt spaziere, die langsam immer mehr Himmel und immer weniger Leben wird, dann kommen diese Gedanken über malerische Worte zu mir. Von Weltschmerz und Frühjahrsmüdigkeit. Ach, die Frühjahrsmüdigkeit - doch jetzt ist Herbst und ich sitze mitten im Herbsttief fest. Der goldene Oktober ist vorbei, der gemütliche Dezember noch nicht gekommen. Mein Herz ist schwer und ein Kopf auch, von zu vielen schweren, sperrigen Gedanken, die das Leben manchmal logischer machen, aber leider nicht leichter.
Wie die Gedanken über die Liebe.
Eine Liebe, die ein ganzes Jahr lang vorsichtig wuchs wie die Blattrosette einer Nachtkerze. Die in der Gemütlichkeit der Nachweihnachtszeit richtig begann, zum Frühjahr hin noch staunte über dieses Wunder und erstarkte, zum Sommer hin erblühte. Die im Hochsommer unter einem Übermaß an Hitze und manchmal auch Trockenheit litt und die jetzt unter den im Jahreslauf gewachsenen, herab segelnden Blättern des Beisammenseins, Getrenntseins, des Eins- und Uneinsseins - von Wind und Tränen zum Fallen gebracht - kaum noch zu sehen ist. Da liegt sie nun, diese Liebe, bedeckt von Vergangenem und nie Gesagtem, ein Haufen welker Blätter.
Ich betrachte sie in diesem Jahreszwielicht mit Abstand, mit Mitgefühl, und frage mich, ob sie nur ein Weilchen schläft um dann wieder zu erwachen, oder ob dieser Winter ihr Tod sein wird. Wie bei einer Nachtkerze, die nach zwei Jahren geblüht hat und ihre Samen in den Wind streut in der Hoffnung, das andere nach ihr kommen werden.
Der erste Frost lässt das Novemberland erstarren. Grashalme blitzen im Morgenlicht von Kristallen und knacken unter den Schuhen. Meine Gedanken kommen zur Ruhe, denn der Frost besetzt sie. Mit dem Aufstehen in der Kälte am Morgen, den frierenden Fingern, dem Entzünden des Feuers im Ofen. Holzhacken. Wasser tragen, wieder quer durch das halbe Bauwagendorf bis in meine Küche, weil die Außenanschlüsse mit Wasser zum Frostschutz geleert wurden. Drei Paar Socken übereinander tragen, weil die Füße morgens stundenlang frieren, bis der Bauwagen endlich richtig warm ist.
Tu etwas, spricht der Frost. Was erstarrt liefert sich dem Tod aus, flüstert der Frost. Hör auf zu denken, fordert der Frost.
Und ich gehorche.
Ich denke nicht. Ich arbeite. Ich heize meinen Wagen, koche heißes Essen, backe die ersten weihnachtlichen Lebkuchen, zeichne ein paar lang erwartete Bilder. Ich fahre in die Universität, ins Labor, versorge meine Pflanzen, ziehe neue an, schließe Experimente ab.
Dann geht der Frost wieder, so wie er kam: über Nacht.
Und die Gedanken sind zurück. Weltschmerz, Frühjahsmüdigkeit. Herbsttief, beschließe ich. Lähmendes, trübendes, trauriges Herbssttief.
Herbstschwere? Oder Herbsttrübsinn?
Herbstwehmut?
Welches Wort nur für dieses seltsame Ding?

Tönende Fenster
Es ist ein Abend im Herbst, dunkel und frostig. Ich gehe langsam durch die Stadt, vorbei an glitzernden Schaufenstern mit erleuchtenden Fenstern darüber, wo Wohnungen gelegen sind, Wohnungen von Menschen, die mir fremd sind.
Die Häuser lächeln mild der Nacht entgegen, wohlig beheizt und bewohnt. Dazwischen verschwinden – wie faule Zähne – einzelne Gebäude im Dunkel. Sie sind nicht älter als die anderen Häuser, doch ihr Putz bröckelt und von den verrammelten Fenstern blättert der Lack. Plakate und Graffiti tummeln sich an ihren Fassaden, ihr Inneres aber ist verödet. Ich fühle mich einsam, als ich an diesen traurigen Häusern vorbei gehe, als seien diese faulen Zähne im adretten Lächeln der Stadt tatsächlich lebendige Wesen, die vor aller Augen einen langsamen Tod sterben. Einsam, aber auch machtlos fühle ich mich. Diese Häuser sind nicht mir zugedacht, nicht ich kann sie retten und wieder mit Leben und Leuchten erfüllen.
Ich wende mich ab von dieser Straße und biege ein in den Schatten des Doms. Ein paar Bäume tanzen im Mondlicht einen Reigen um die Kirche und wispern dabei eine schwermütige Weise, die lauter wird als ich mich ihnen nähere, bis ich vor einem erleuchteten Fenster stehen bleibe.
Schon oft habe ich auf meinem abendlichen Weg an diesem Bilderrahmen in eine andere Wirklichkeit angehalten, um hinein in den Saal zu schauen, auf die Bühne und die Menschen, die auf der anderen Seite des Fensters in die gleiche Richtung schauen wie ich. Wir sind uns so ähnlich, doch das Glas trennt uns. Wie die leeren Häuser nicht bestimmt sind, von mir gefüllt zu werden – sondern nur dazu, dass ich sie anschaue – so ist auch dieser Saal umso magischer für mich, weil ihn ihn nur durch den Rahmen des Fensters kenne: das alte Fachwerk, in das moderne Beleuchtung und eine Empore eingefügt wurden, die Reihen von Stühlen und die immer verschiedenen Sänger auf der kleinen Bühne.
Das Fenster verzaubert mich.
Auch die Bäume sind verzaubert. Sie singen im Klang der Töne, die aus dem leuchtenden Raum in die Nachtluft schweben. Schlagzeug, elektronische Gitarre, Geige und Flöte begleiten ein Lied von verlorenen Geistern, die ihr Leid klagen, beleuchtet von farbigen Lichtern.
Verlorene Geister, die rastlos wandern, an kalten Seen, in der Einsamkeit der Nacht, die das Verhallen ihrer unbeantworteten Stimmen nicht ertragen.
… all mein Grün musste fallen, meine Seele ist rastlos …
Und ich fühle, wie meine Füße Wurzeln schlagen.
… Kannst du es nicht auch fühlen, wenn der Winter im Mai noch einmal Frost über das Land haucht? Wenn deine Liebsten weit fort sind?
Wie kannst du diesen Schmerz ertragen, wenn die schwersten Albträume dich plagen? …
Die Geige erhebt eindringlich ihre Stimme. Ein Saal voller Menschen lauscht andächtig der Klage, die Bäume lauschen, der Dom und auch ich, draußen vor meinem Fenster. Wir alle sind bewegt von den Klängen. Ich fühle mich verloren und geborgen zugleich.
… Errette mein Grün, es musste alles fallen, errette meine Ängste, sie verfolgen euch im Schlaf. Hilf mir, mein Herz liegt am Boden …
Kurz glaube ich fast, die Türen neben dem Fenster würden sich öffnen, leuchtend in der Nacht, und mich einladen, weil sie meine Einsamkeit spüren. Als sei die Klage der Geister in dem Lied meine eigene Stimme, die endlich Gehör findet und von dem Haus beantwortet wird, das mich umfängt und in den Saal hinein bittet, in diesen Saal voller Lichter und Wärme und Klänge und Menschen, zu denen ich dann endlich dazugehören darf.
Doch das Lied verstummt. Die Tür bleibt zu. Das Fenster verliert seinen Zauber, als es nur noch Bild ist und nicht mehr Klang.
Ich packe fest den Riemen meiner Tasche und schon verlieren meine Füße ihre Wurzeln und tragen mich fort von dem Fenster, vorbei an Schatten, so groß wie Häuser und Bäume, die mir im Wind mit den Zweigen drohen. Straft mich die Nacht dafür, dass ich mir wünschte, was nicht für mich gedacht ist? Alle Fenster, selbst alle Straßenlaternen an meinem Weg scheinen verloschen zu sein, als ich über des Kopfsteinpflaster stolpere. Und ich fühle es.
Als käme der Winter im Mai zurück ins Land, als wären all meine Liebsten unendlich weit fort und ich ganz allein auf der Welt.
Ich erreiche die Tür zum Mietshaus in Düsternis, finde kaum das Schloss und bin schon den Tränen nahe, als die Tür sich endlich öffnet und Licht aus dem Treppenhaus in meine Seele flutet. Endlich kann ich wieder ruhiger atmen.
Dann erst bemerke ich eine grauhaarige Frau, die eine bunte Strickjacke über mehreren Pullovern trägt. Drei volle Plastiktaschen stehen neben ihr, wie sie sich im Eingang des nächsten Hauses vor dem Wind duckt. Unsere Blicke treffen sich im Licht der geöffneten Tür.
An jedem anderen Tag wäre ich wohl einfach hinein gegangen und hätte die Tür hinter mir ins Schloss gezogen. Nun aber sehe ich die unausgesprochene Bitte in der Haltung der Frau, den Stolz, der sie Schweigen lässt, und ihre Einsamkeit. Und die Musik des tönenden Fensters öffnet die Haustür weiter. Ich lächle gegen die Einsamkeit an und lasse eine Fremde ein.
Die Wärme und das Licht des Hauses heißen uns beide willkommen.
Grüne Hallen & Gläserne Decken
Mich umgibt das Murmeln von Stimmen wie Klänge aus einer friedlichen, grünen Welt. Doch nicht Bäume bilden den Wald, sondern die Köpfe der Menschen, die vor mir in Reihen sitzen und erwartungsvoll auf fünf grüne Stühle schauen. Eine Brise geht durch die Menge und macht sie verstummen, als jemand vorne zu sprechen beginnt. Ich lausche den Worten und dem Sinn dahinter, bis die Sätze vieler Menschen mich umspülen und nur ein Bild verweilt und sich ausdehnt: der Schimmer einer gläsernen Decke.
Sie umspannt in einem weiten Bogen die Welt, ist hier dicker, dort dünner angelegt. Hier zart, nur ein Hauch mundgeblasenes Glas, schillernd und beinahe unsichtbar, sogar mit einer gewissen Schönheit versehen; Dort meterdick und hart wie Panzerglas, unzerbrechlich und erstickend.
Ich sitze auf einem unbequemen Stuhl und blicke empor, sehe sie dort schweben. Hier scheint sie so dünn, dass ich sie manchmal kaum sehe, so dünn, dass sie anderen noch nie aufgefallen ist, so dünn, dass Menschen sie leugnen und für verrückt erklären, wer sie sieht und auch noch von der Erscheinung zu sprechen wagt.
Versuch du nun, sie einzuschlagen, Schwester, denn darüber siehst du den blauen Himmel und denkst, dort oben kannst du fliegen; Ich schaue dir zu. Vielleicht gelingt es dir ja.
Du baust die eine Leiter – deine Eltern haben dir ja schon beigebracht, wie das geht – und kletterst empor. Dein erster Schlag ist zu schwach, du stößt dir nur schmerzhaft die Knöchel an dem Glas, das doch so hauchzart erscheint. Du wirst wütend und holst erneut aus, schlägst ein Loch in die gläserne Decke. Ein paar Splitter regnen herab und deine Knöchel schneiden sich am scharfen Glas.
Nur: Das Loch ist zu klein. Wie willst du dort hindurch klettern?
Wirf einen Blick nach unten. Dort stehen deine Schwestern. Die meisten von ihnen kennst du nicht, sie wollen nicht das gleiche wie du und sie denken auch anders. Manche sehen die gläserne Decke nicht und geben sich nur selbst die Schuld, weil sie den blauen Himmel noch nie erreichen konnten. Diese Versagerinnen. Andere mustern die Decke und schütteln den Kopf; Sie nehmen ihre Kinder an die Hand und wenden sich ab. Der blaue Himmel ist nicht alle Opfer wert. Sie können auch so glücklich sein, sagen sie sich.
Du verstehst nicht, warum außer dir niemand eine Leiter gebaut hast, dabei bemerkst du nicht, dass unten zwei Frauen stehen und deine Leiter halten, damit du sicher klettern kannst, dass du anderen Dinge fort genommen hast, um deine eigene Leiter zu bauen. Dass die Scherben deines Schlages gegen das Glas dir zugewandte Gesichter zerschnitten haben.
Alles, was du siehst, ist das kleine Loch in der gläsernen Decke. Das Blut auf deiner Hand. Und du willst nicht aufgeben.
Wieder und wieder schlägst du auf das Glas, erweiterst das Loch, bis dir Blut über beide Arme läuft und der Schmerz dich nur weiter vorantreibt, denn unter dem blauen Himmel, das glaubst du, wird der Schmerz aufhören. Endlich ist das Loch so groß, dass du die frische Luft um deine Nase spürst. Mit blutigen Händen ergreifst du die Kante. Du ziehst dich hoch und stürzt die Leiter dabei um, trittst noch einmal hart dagegen, sodass sie am Boden zerschellt. Es ist deine Leistung, du allein hast die Glasdecke durchbrochen. Sollen sich andere eigene Leitern bauen.
Du schaust hinauf in den blauen Himmel.
Doch der Schmerz hört nicht auf. Er macht nicht einmal mehr einen Sinn. Irgendwann spürst du einfach gar nichts mehr. Nicht einmal dann, wenn du nach unten schaust, wo deine Scherben ein Blutbad angerichtet haben und die beiden Schwestern, die deine Leiter hielten, von deinem Machwerk erschlagen wurden.
Sie alle hätten auch vollbringen können, was du getan hast.
Aber weißt du was?
Viele wollten es nicht.
Wir können Löcher in diese Glasdecke schlagen, hier, wo sie dünn und scharf ist. Jede für sich. Du hast dafür gekämpft und gelitten. Warum kämpfen wir nicht zusammen? Warum schlagen wir nicht die ganze Decke ein?
Denn was du nicht siehst: Für dich war sie nur ein Hauch. Doch andere stehen vor armdickem Glas. Wie sollen sie das einschlagen? Warum sollen sie das müssen?
Und noch etwas siehst du nicht: Der blaue Himmel ist nicht das Ziel, sondern nur ein Weg unter vielen. Er ist die Freiheit, sich zu entscheiden. Du siehst das nicht mehr. Du stehst auf der gläsernen Decke und schaust dich um, und alles was du siehst, ist dein Erfolg.
Die moralische Leitwährung: Was Erfolg bringt, ist gut. Aber was ist Erfolg?
Ich stehe unten, unsicher, ob ich mich an der gläsernen Decke versuchen soll oder ob ich mich ganz wohl fühle, wo ich jetzt bin. Ich schaue empor und sehe dich.
Nur für mich allein würde ich mir die Mühe wohl nicht machen, die du auf dich genommen hast. Ich bin nicht so gut darin, Leitern zu bauen. Es liegt mir einfach nicht. Ich bin auch nicht so gut im Klettern, denn mir fehlen die Ellenbogen dafür.
Meine Zukunft liegt vor mir als ein großes, weites Land, über dem die gläserne Decke charmant in der Sonne schillert, wie ein ironisches Lächeln. Ich kann so viele Wege gehen. Ich muss mich nicht einsam durch die Glasdecke kämpfen.
Denn ich stehe nicht allein.
Langsam taucht das Podium wieder vor mir auf, wie eine Insel in der Ferne. Das Meer von Köpfen trennt mich von denen, die dort sprechen, und verbindet mich zugleich mit ihnen. Ein Meer aus Haaren; Kurzhaarfrisuren in allen Farben von weiß bis rot, Lockenköpfe, lange Mähnen in schwarz oder blond und allen Schattierungen dazwischen, punkige Sidecuts, elegante Flechtzöpfe und Hochsteckfrisuren; Volles Haar auf vielen Köpfen, vom Denken und Leben schütter gewordenes auf anderen.
Eine Rednerin formuliert ein schönes Schlusswort, das mich aus meinen Gedankenbildern auftauchen lässt. Alle klatschen, ich auch.
Dieses Panel hat mir mehr gegeben als nur Wissen über die diskutierten Themen. Es hat mir ein Bild gegeben und Farben. Für mich gibt es wenig, das wertvoller wäre.
… abgedriftet bei Dare the Im_possible : Wage das Un_mögliche
feministischer Kongress
15. bis 18. Oktober 2015
Heinrich Böll Stiftung Berlin
Die Zeit für das Glück ist heute, nicht morgen
Es war ein regnerischer und windiger Sonntagmorgen, das Licht vor den Fenstern war gräulich. Immer wieder brachen aus den Wolken unerwartete Schauer hervor, die sich unter den Peitschen der Böen wie echter Sturzregen anfühlen. Die Erde saugte dankbar die Feuchte in sich auf und alle Pflanzen, obwohl windzerzaust, schienen nach der heißen Trockenheit der letzten Tage aufzuatmen.
Seit dem Aufstehen erfüllte mich eine fast wohlige Melancholie, die durch jeden Augenblick des Morgens genährt wurde: das vorwurfsvolle Piepsen der nassen Gänseküken, die mir dennoch voll Vorfreude auf ihr Frühstück entgegen stapften, die feucht herabhängenden Mohnblüten in meinem Garten, die Ringelblumen, die offenen Auges hinauf in den Regenhimmel schauten, als hofften sie die Sonne als ihr Spiegelbild dort zu sehen.
Es wäre ein perfekter Tag zum Schreiben, Zeichnen und Musizieren gewesen, wie immer, wenn mich diese Stimmung erfasst, doch es nährte meine Melancholie nur weiter, dass diese Verbindung mit meinem Sehnen unmöglich war. Die Entwicklungsphysiologie der Pflanzen harrte meiner Aufmerksamkeit, mit Phytohormonen, chemischen Sythesewegen, Blühinduktion und Seneszenz, denn die letzten Tage war ich schon hinter meinem Lernpensum für die Klausur zurückgeblieben.
Ich machte es mir gemütlich, draußen das graue Seufzen des Regenwetters, drinnen Kerzenschein und Buchweizenpfannkuchen, die Luft meines Bauwagens durchwabert von Lavendelduft und den Klängen der philippinischen Musikgruppe Asin, so melancholisch und pathetisch, wie ich mich fühlte.
Und ich lernte.
Lernte fleißig und mit Interesse, obwohl ich doch in den vergangenen Wochen der Klausurvorbereitung mehr und mehr das Gefühl bekommen hatte, als würde ich einen Teil meines Selbst – den träumenden, künstlerischen und schöpferischen Teil – langsam und grausam mit endlosen Ketten aus toten Fakten strangulieren. Jeden Abend, wenn ich in meinem Garten saß, litt ich unter einer Schwermut, die sich mit dem schlechten Gewissen über den mangelnden Lerneifer die Waage hielt und mich lähmte, sodass ich unfähig war, meiner Erkenntnis zu folgen.
Ich müsste etwas zeichnen, etwas schreiben, dann würde ich mich besser fühlen, mit mir selbst wieder vereint. Doch ich konnte es nicht. Nur unglücklich darüber sein, dass weder Wörter noch Striche zu mir kamen und ins Leben gebracht werden wollten.
So saß ich also an diesem Sonntagmorgen an meinem Fenster mit Blick hinaus in die graue Regenwelt und lernte: Samenruhe, Abscisin- und Gibberellinsäure, Stratifikation. Keimung.
Plötzlich schreckte ein dumpfer Knall neben meinem Kopf mich auf und ich sah noch ein paar braune Federn stieben, ehe etwas Dunkles meinem Sichtfeld entfiel. Ich sprang auf, so schnell die gestapelten Bücher auf meinem Schoß es erlaubten, und eilte die Wagentreppe hinab, in die Welt des Nieselregens, in der eine braun getupfte Drossel mit seltsam verdrehtem Kopf in meinem Blumenbeet lag. Ohne Nachdenken griff ich nach ihr, berührte die samtigen Federn.
Einmal zappelte der Vogel noch mit den Krallen, blinzelte, ehe er ganz still wurde, die Augen nur halb geschlossen. Als ich den warmen kleinen Körper in meine Hände nahm, kamen mir die Tränen.
Gerade war die Drossel noch übermütig umher geflogen, sehr schnell wohl der Wucht nach, mit der sie gegen meine Fensterscheibe geprallt war, voller Freude über die Kraft ihrer Flügel und den Schwung des raschen Fliegens. Und nun lag sie schlaff in meinen Händen. So schnell kann es gehen.
Gleichzeitig bezauberte mich die Anmut des Vogels, der lange Fiederschwanz, der im Leben sicher munter gewippt war, die gefalteten Flügel und zierlichen dunklen Krallen. Den Vogel auf den Händen lief ich in meinen Bauwagen zurück, bettete das Tier auf ein Zeitungsblatt und kniete mich mit Stift und Papier davor auf den Teppich. Fast war mir, als hätte mir die Drossel mit ihrem Tod vor meinem Fenster ein Geschenk gemacht.
Die Zeit für das Glück ist heute, nicht morgen!
Ich zeichnete die liebe Drossel, die mich so sehr anrührte und mir zugleich die Wahrheit der Vergänglichkeit vor Augen führte. Ich zeichnete sie, weil sie noch im Tod so schön war und weil ich diesen Augenblick nicht vergessen wollte.
Die Zeit für das Glück ist heute, nicht morgen.
Schon vor einer Woche stand dieser Spruch auf meinem Kalender, doch nur mein Kopf hatte ihn begriffen. Nun verstand auch mein Herz, mit einem Aufschluchzen und einem Lachen zugleich. Die Zeichnung floss nur so auf das Papier und mich ergriff das wunderbare Gefühl des Einklangs, das mich immer dann erfüllt, wenn die richtige Schöpfung zum richtigen Zeitpunkt geboren wird. Ein geschenktes Glück.
Noch einmal streichelte ich leicht über die weichen Brustfedern der Drossel, ehe ich sie an meiner Telekie begrub, die mit ihren gelben Blüten der hervor blitzenden Sonne zulächelte.
Rabe
Ich erwache zum Rauschen der Pappeln im Wind, diesem Brausen, das heimelig ist und beängstigend zugleich. Eine Stimme der Herbstwinde, die Blatt um Blatt von den Zweigen fegen.
Ach, ich wünschte so sehr, ich könnte länger im Bett liegen bleiben und lesen, warm und wohlig, an meinem Bauch eine schnurrende Katze. Doch die Zeit ist unerbittlich, der Hörsaal ruft. Ich erhebe mich mit dem Gähnen der Sonne und als ich mit dem Fahrrad dem Wind entgegen auf dem Feldweg fahre, errötet die Welt gerade im Sturmmorgenlicht, diesem unnachahmlichen Farbton, in dem alles irgendwie traumartig scheint.
Über mir ziehen Gruppen von Gänsen weiter nach Südwesten, fort von jenem Ort, zu dem ich nun auf dem Weg bin. Wie gern würde ich ihnen folgen! Fliegen, gleiten, vom Wind getragen, der mir unlieb Kälte ins Gesicht haucht, fort von den Verpflichtungen, frei und auf einer großen Reise.
Ich rufe zu ihnen empor: »Gute Reise! Grüßt mir den Süden!«
Eine Stimme antwortet mir, eine Stimme, die ich kenne, und schon sehe ich ihn als schwarzen Schatten über der Hecke. Größer erscheint er mir als die ziehenden Gänse, wie er durch die Böen tollt, sich trudelnd fallen lässt und mit geschicktem Flügelschlag abfängt, auf und ab, auf und ab, Kreisel und Salti. Er vollführt kühne Kapriolen, tanzt und spielt mit dem Sturm, während die Gänse weiter ins sichere Inland ziehen.
Als ich näher komme, lässt er sich auf einem Strommast nieder, wo er sich mir als stolzer Schattenriss präsentiert, sich ein wenig plustert und reckt und mir zuruft: »Krrok, krrok krrok!«
Keine Vogelstimme liebe ich so wie diesen hölzernen Ruf des Raben. »Guten Morgen, mein Freund«, werfe ich ihm meine Liebe in den Wind. »Du bis doch von allen der Schönste!«
»Krrok, krrok, krrok!«, gibt er mir seine Stimme mit auf den Weg.
Ja, ich will Rabe sein. Und wenn ich im Labor stehe, wenn ich keine Lust mehr habe und müde bin und nicht weiter weiß, werde ich lachen und dem Sturm zeigen, dass ich keine Angst vor ihm habe. Denn mein Leben gehört mir und ich lasse mich nicht beeindrucken, wenn ich es nicht will. Lieber bin ich frech, ein Schelm, mit einem hölzernen Ruf und glänzend nachtschwarzem Gefieder, an dem aller Regen abperlt.
Rabe will ich sein.
Jahreszwielicht
Es gibt viele malerische Begriffe in unserer Sprache. Dafür – so meine ich gelesen zu haben – ist das Deutsche recht bekannt, als Sprache der Dichter und Denker. Zumindest früher einmal.
Wie auch immer, auf jeden Fall haben wir Wörter für wahrlich seltsame Dinge.
Wenn ich in diesem Zwielicht des Jahres zwischen dem letzten Herbstlaub und dem ersten Wintergrau durch die Welt spaziere, die langsam immer mehr Himmel und immer weniger Leben wird, dann kommen diese Gedanken über malerische Worte zu mir. Von Weltschmerz und Frühjahrsmüdigkeit. Ach, die Frühjahrsmüdigkeit - doch jetzt ist Herbst und ich sitze mitten im Herbsttief fest. Der goldene Oktober ist vorbei, der gemütliche Dezember noch nicht gekommen. Mein Herz ist schwer und ein Kopf auch, von zu vielen schweren, sperrigen Gedanken, die das Leben manchmal logischer machen, aber leider nicht leichter.
Wie die Gedanken über die Liebe.
Eine Liebe, die ein ganzes Jahr lang vorsichtig wuchs wie die Blattrosette einer Nachtkerze. Die in der Gemütlichkeit der Nachweihnachtszeit richtig begann, zum Frühjahr hin noch staunte über dieses Wunder und erstarkte, zum Sommer hin erblühte. Die im Hochsommer unter einem Übermaß an Hitze und manchmal auch Trockenheit litt und die jetzt unter den im Jahreslauf gewachsenen, herab segelnden Blättern des Beisammenseins, Getrenntseins, des Eins- und Uneinsseins - von Wind und Tränen zum Fallen gebracht - kaum noch zu sehen ist. Da liegt sie nun, diese Liebe, bedeckt von Vergangenem und nie Gesagtem, ein Haufen welker Blätter.
Ich betrachte sie in diesem Jahreszwielicht mit Abstand, mit Mitgefühl, und frage mich, ob sie nur ein Weilchen schläft um dann wieder zu erwachen, oder ob dieser Winter ihr Tod sein wird. Wie bei einer Nachtkerze, die nach zwei Jahren geblüht hat und ihre Samen in den Wind streut in der Hoffnung, das andere nach ihr kommen werden.
Der erste Frost lässt das Novemberland erstarren. Grashalme blitzen im Morgenlicht von Kristallen und knacken unter den Schuhen. Meine Gedanken kommen zur Ruhe, denn der Frost besetzt sie. Mit dem Aufstehen in der Kälte am Morgen, den frierenden Fingern, dem Entzünden des Feuers im Ofen. Holzhacken. Wasser tragen, wieder quer durch das halbe Bauwagendorf bis in meine Küche, weil die Außenanschlüsse mit Wasser zum Frostschutz geleert wurden. Drei Paar Socken übereinander tragen, weil die Füße morgens stundenlang frieren, bis der Bauwagen endlich richtig warm ist.
Tu etwas, spricht der Frost. Was erstarrt liefert sich dem Tod aus, flüstert der Frost. Hör auf zu denken, fordert der Frost.
Und ich gehorche.
Ich denke nicht. Ich arbeite. Ich heize meinen Wagen, koche heißes Essen, backe die ersten weihnachtlichen Lebkuchen, zeichne ein paar lang erwartete Bilder. Ich fahre in die Universität, ins Labor, versorge meine Pflanzen, ziehe neue an, schließe Experimente ab.
Dann geht der Frost wieder, so wie er kam: über Nacht.
Und die Gedanken sind zurück. Weltschmerz, Frühjahsmüdigkeit. Herbsttief, beschließe ich. Lähmendes, trübendes, trauriges Herbssttief.
Herbstschwere? Oder Herbsttrübsinn?
Herbstwehmut?
Welches Wort nur für dieses seltsame Ding?

Tönende Fenster
Es ist ein Abend im Herbst, dunkel und frostig. Ich gehe langsam durch die Stadt, vorbei an glitzernden Schaufenstern mit erleuchtenden Fenstern darüber, wo Wohnungen gelegen sind, Wohnungen von Menschen, die mir fremd sind.
Die Häuser lächeln mild der Nacht entgegen, wohlig beheizt und bewohnt. Dazwischen verschwinden – wie faule Zähne – einzelne Gebäude im Dunkel. Sie sind nicht älter als die anderen Häuser, doch ihr Putz bröckelt und von den verrammelten Fenstern blättert der Lack. Plakate und Graffiti tummeln sich an ihren Fassaden, ihr Inneres aber ist verödet. Ich fühle mich einsam, als ich an diesen traurigen Häusern vorbei gehe, als seien diese faulen Zähne im adretten Lächeln der Stadt tatsächlich lebendige Wesen, die vor aller Augen einen langsamen Tod sterben. Einsam, aber auch machtlos fühle ich mich. Diese Häuser sind nicht mir zugedacht, nicht ich kann sie retten und wieder mit Leben und Leuchten erfüllen.
Ich wende mich ab von dieser Straße und biege ein in den Schatten des Doms. Ein paar Bäume tanzen im Mondlicht einen Reigen um die Kirche und wispern dabei eine schwermütige Weise, die lauter wird als ich mich ihnen nähere, bis ich vor einem erleuchteten Fenster stehen bleibe.
Schon oft habe ich auf meinem abendlichen Weg an diesem Bilderrahmen in eine andere Wirklichkeit angehalten, um hinein in den Saal zu schauen, auf die Bühne und die Menschen, die auf der anderen Seite des Fensters in die gleiche Richtung schauen wie ich. Wir sind uns so ähnlich, doch das Glas trennt uns. Wie die leeren Häuser nicht bestimmt sind, von mir gefüllt zu werden – sondern nur dazu, dass ich sie anschaue – so ist auch dieser Saal umso magischer für mich, weil ihn ihn nur durch den Rahmen des Fensters kenne: das alte Fachwerk, in das moderne Beleuchtung und eine Empore eingefügt wurden, die Reihen von Stühlen und die immer verschiedenen Sänger auf der kleinen Bühne.
Das Fenster verzaubert mich.
Auch die Bäume sind verzaubert. Sie singen im Klang der Töne, die aus dem leuchtenden Raum in die Nachtluft schweben. Schlagzeug, elektronische Gitarre, Geige und Flöte begleiten ein Lied von verlorenen Geistern, die ihr Leid klagen, beleuchtet von farbigen Lichtern.
Verlorene Geister, die rastlos wandern, an kalten Seen, in der Einsamkeit der Nacht, die das Verhallen ihrer unbeantworteten Stimmen nicht ertragen.
… all mein Grün musste fallen, meine Seele ist rastlos …
Und ich fühle, wie meine Füße Wurzeln schlagen.
… Kannst du es nicht auch fühlen, wenn der Winter im Mai noch einmal Frost über das Land haucht? Wenn deine Liebsten weit fort sind?
Wie kannst du diesen Schmerz ertragen, wenn die schwersten Albträume dich plagen? …
Die Geige erhebt eindringlich ihre Stimme. Ein Saal voller Menschen lauscht andächtig der Klage, die Bäume lauschen, der Dom und auch ich, draußen vor meinem Fenster. Wir alle sind bewegt von den Klängen. Ich fühle mich verloren und geborgen zugleich.
… Errette mein Grün, es musste alles fallen, errette meine Ängste, sie verfolgen euch im Schlaf. Hilf mir, mein Herz liegt am Boden …
Kurz glaube ich fast, die Türen neben dem Fenster würden sich öffnen, leuchtend in der Nacht, und mich einladen, weil sie meine Einsamkeit spüren. Als sei die Klage der Geister in dem Lied meine eigene Stimme, die endlich Gehör findet und von dem Haus beantwortet wird, das mich umfängt und in den Saal hinein bittet, in diesen Saal voller Lichter und Wärme und Klänge und Menschen, zu denen ich dann endlich dazugehören darf.
Doch das Lied verstummt. Die Tür bleibt zu. Das Fenster verliert seinen Zauber, als es nur noch Bild ist und nicht mehr Klang.
Ich packe fest den Riemen meiner Tasche und schon verlieren meine Füße ihre Wurzeln und tragen mich fort von dem Fenster, vorbei an Schatten, so groß wie Häuser und Bäume, die mir im Wind mit den Zweigen drohen. Straft mich die Nacht dafür, dass ich mir wünschte, was nicht für mich gedacht ist? Alle Fenster, selbst alle Straßenlaternen an meinem Weg scheinen verloschen zu sein, als ich über des Kopfsteinpflaster stolpere. Und ich fühle es.
Als käme der Winter im Mai zurück ins Land, als wären all meine Liebsten unendlich weit fort und ich ganz allein auf der Welt.
Ich erreiche die Tür zum Mietshaus in Düsternis, finde kaum das Schloss und bin schon den Tränen nahe, als die Tür sich endlich öffnet und Licht aus dem Treppenhaus in meine Seele flutet. Endlich kann ich wieder ruhiger atmen.
Dann erst bemerke ich eine grauhaarige Frau, die eine bunte Strickjacke über mehreren Pullovern trägt. Drei volle Plastiktaschen stehen neben ihr, wie sie sich im Eingang des nächsten Hauses vor dem Wind duckt. Unsere Blicke treffen sich im Licht der geöffneten Tür.
An jedem anderen Tag wäre ich wohl einfach hinein gegangen und hätte die Tür hinter mir ins Schloss gezogen. Nun aber sehe ich die unausgesprochene Bitte in der Haltung der Frau, den Stolz, der sie Schweigen lässt, und ihre Einsamkeit. Und die Musik des tönenden Fensters öffnet die Haustür weiter. Ich lächle gegen die Einsamkeit an und lasse eine Fremde ein.
Die Wärme und das Licht des Hauses heißen uns beide willkommen.
Grüne Hallen & Gläserne Decken
Mich umgibt das Murmeln von Stimmen wie Klänge aus einer friedlichen, grünen Welt. Doch nicht Bäume bilden den Wald, sondern die Köpfe der Menschen, die vor mir in Reihen sitzen und erwartungsvoll auf fünf grüne Stühle schauen. Eine Brise geht durch die Menge und macht sie verstummen, als jemand vorne zu sprechen beginnt. Ich lausche den Worten und dem Sinn dahinter, bis die Sätze vieler Menschen mich umspülen und nur ein Bild verweilt und sich ausdehnt: der Schimmer einer gläsernen Decke.
Sie umspannt in einem weiten Bogen die Welt, ist hier dicker, dort dünner angelegt. Hier zart, nur ein Hauch mundgeblasenes Glas, schillernd und beinahe unsichtbar, sogar mit einer gewissen Schönheit versehen; Dort meterdick und hart wie Panzerglas, unzerbrechlich und erstickend.
Ich sitze auf einem unbequemen Stuhl und blicke empor, sehe sie dort schweben. Hier scheint sie so dünn, dass ich sie manchmal kaum sehe, so dünn, dass sie anderen noch nie aufgefallen ist, so dünn, dass Menschen sie leugnen und für verrückt erklären, wer sie sieht und auch noch von der Erscheinung zu sprechen wagt.
Versuch du nun, sie einzuschlagen, Schwester, denn darüber siehst du den blauen Himmel und denkst, dort oben kannst du fliegen; Ich schaue dir zu. Vielleicht gelingt es dir ja.
Du baust die eine Leiter – deine Eltern haben dir ja schon beigebracht, wie das geht – und kletterst empor. Dein erster Schlag ist zu schwach, du stößt dir nur schmerzhaft die Knöchel an dem Glas, das doch so hauchzart erscheint. Du wirst wütend und holst erneut aus, schlägst ein Loch in die gläserne Decke. Ein paar Splitter regnen herab und deine Knöchel schneiden sich am scharfen Glas.
Nur: Das Loch ist zu klein. Wie willst du dort hindurch klettern?
Wirf einen Blick nach unten. Dort stehen deine Schwestern. Die meisten von ihnen kennst du nicht, sie wollen nicht das gleiche wie du und sie denken auch anders. Manche sehen die gläserne Decke nicht und geben sich nur selbst die Schuld, weil sie den blauen Himmel noch nie erreichen konnten. Diese Versagerinnen. Andere mustern die Decke und schütteln den Kopf; Sie nehmen ihre Kinder an die Hand und wenden sich ab. Der blaue Himmel ist nicht alle Opfer wert. Sie können auch so glücklich sein, sagen sie sich.
Du verstehst nicht, warum außer dir niemand eine Leiter gebaut hast, dabei bemerkst du nicht, dass unten zwei Frauen stehen und deine Leiter halten, damit du sicher klettern kannst, dass du anderen Dinge fort genommen hast, um deine eigene Leiter zu bauen. Dass die Scherben deines Schlages gegen das Glas dir zugewandte Gesichter zerschnitten haben.
Alles, was du siehst, ist das kleine Loch in der gläsernen Decke. Das Blut auf deiner Hand. Und du willst nicht aufgeben.
Wieder und wieder schlägst du auf das Glas, erweiterst das Loch, bis dir Blut über beide Arme läuft und der Schmerz dich nur weiter vorantreibt, denn unter dem blauen Himmel, das glaubst du, wird der Schmerz aufhören. Endlich ist das Loch so groß, dass du die frische Luft um deine Nase spürst. Mit blutigen Händen ergreifst du die Kante. Du ziehst dich hoch und stürzt die Leiter dabei um, trittst noch einmal hart dagegen, sodass sie am Boden zerschellt. Es ist deine Leistung, du allein hast die Glasdecke durchbrochen. Sollen sich andere eigene Leitern bauen.
Du schaust hinauf in den blauen Himmel.
Doch der Schmerz hört nicht auf. Er macht nicht einmal mehr einen Sinn. Irgendwann spürst du einfach gar nichts mehr. Nicht einmal dann, wenn du nach unten schaust, wo deine Scherben ein Blutbad angerichtet haben und die beiden Schwestern, die deine Leiter hielten, von deinem Machwerk erschlagen wurden.
Sie alle hätten auch vollbringen können, was du getan hast.
Aber weißt du was?
Viele wollten es nicht.
Wir können Löcher in diese Glasdecke schlagen, hier, wo sie dünn und scharf ist. Jede für sich. Du hast dafür gekämpft und gelitten. Warum kämpfen wir nicht zusammen? Warum schlagen wir nicht die ganze Decke ein?
Denn was du nicht siehst: Für dich war sie nur ein Hauch. Doch andere stehen vor armdickem Glas. Wie sollen sie das einschlagen? Warum sollen sie das müssen?
Und noch etwas siehst du nicht: Der blaue Himmel ist nicht das Ziel, sondern nur ein Weg unter vielen. Er ist die Freiheit, sich zu entscheiden. Du siehst das nicht mehr. Du stehst auf der gläsernen Decke und schaust dich um, und alles was du siehst, ist dein Erfolg.
Die moralische Leitwährung: Was Erfolg bringt, ist gut. Aber was ist Erfolg?
Ich stehe unten, unsicher, ob ich mich an der gläsernen Decke versuchen soll oder ob ich mich ganz wohl fühle, wo ich jetzt bin. Ich schaue empor und sehe dich.
Nur für mich allein würde ich mir die Mühe wohl nicht machen, die du auf dich genommen hast. Ich bin nicht so gut darin, Leitern zu bauen. Es liegt mir einfach nicht. Ich bin auch nicht so gut im Klettern, denn mir fehlen die Ellenbogen dafür.
Meine Zukunft liegt vor mir als ein großes, weites Land, über dem die gläserne Decke charmant in der Sonne schillert, wie ein ironisches Lächeln. Ich kann so viele Wege gehen. Ich muss mich nicht einsam durch die Glasdecke kämpfen.
Denn ich stehe nicht allein.
Langsam taucht das Podium wieder vor mir auf, wie eine Insel in der Ferne. Das Meer von Köpfen trennt mich von denen, die dort sprechen, und verbindet mich zugleich mit ihnen. Ein Meer aus Haaren; Kurzhaarfrisuren in allen Farben von weiß bis rot, Lockenköpfe, lange Mähnen in schwarz oder blond und allen Schattierungen dazwischen, punkige Sidecuts, elegante Flechtzöpfe und Hochsteckfrisuren; Volles Haar auf vielen Köpfen, vom Denken und Leben schütter gewordenes auf anderen.
Eine Rednerin formuliert ein schönes Schlusswort, das mich aus meinen Gedankenbildern auftauchen lässt. Alle klatschen, ich auch.
Dieses Panel hat mir mehr gegeben als nur Wissen über die diskutierten Themen. Es hat mir ein Bild gegeben und Farben. Für mich gibt es wenig, das wertvoller wäre.
… abgedriftet bei Dare the Im_possible : Wage das Un_mögliche
feministischer Kongress
15. bis 18. Oktober 2015
Heinrich Böll Stiftung Berlin
Die Zeit für das Glück ist heute, nicht morgen
Es war ein regnerischer und windiger Sonntagmorgen, das Licht vor den Fenstern war gräulich. Immer wieder brachen aus den Wolken unerwartete Schauer hervor, die sich unter den Peitschen der Böen wie echter Sturzregen anfühlen. Die Erde saugte dankbar die Feuchte in sich auf und alle Pflanzen, obwohl windzerzaust, schienen nach der heißen Trockenheit der letzten Tage aufzuatmen.
Seit dem Aufstehen erfüllte mich eine fast wohlige Melancholie, die durch jeden Augenblick des Morgens genährt wurde: das vorwurfsvolle Piepsen der nassen Gänseküken, die mir dennoch voll Vorfreude auf ihr Frühstück entgegen stapften, die feucht herabhängenden Mohnblüten in meinem Garten, die Ringelblumen, die offenen Auges hinauf in den Regenhimmel schauten, als hofften sie die Sonne als ihr Spiegelbild dort zu sehen.
Es wäre ein perfekter Tag zum Schreiben, Zeichnen und Musizieren gewesen, wie immer, wenn mich diese Stimmung erfasst, doch es nährte meine Melancholie nur weiter, dass diese Verbindung mit meinem Sehnen unmöglich war. Die Entwicklungsphysiologie der Pflanzen harrte meiner Aufmerksamkeit, mit Phytohormonen, chemischen Sythesewegen, Blühinduktion und Seneszenz, denn die letzten Tage war ich schon hinter meinem Lernpensum für die Klausur zurückgeblieben.
Ich machte es mir gemütlich, draußen das graue Seufzen des Regenwetters, drinnen Kerzenschein und Buchweizenpfannkuchen, die Luft meines Bauwagens durchwabert von Lavendelduft und den Klängen der philippinischen Musikgruppe Asin, so melancholisch und pathetisch, wie ich mich fühlte.
Und ich lernte.
Lernte fleißig und mit Interesse, obwohl ich doch in den vergangenen Wochen der Klausurvorbereitung mehr und mehr das Gefühl bekommen hatte, als würde ich einen Teil meines Selbst – den träumenden, künstlerischen und schöpferischen Teil – langsam und grausam mit endlosen Ketten aus toten Fakten strangulieren. Jeden Abend, wenn ich in meinem Garten saß, litt ich unter einer Schwermut, die sich mit dem schlechten Gewissen über den mangelnden Lerneifer die Waage hielt und mich lähmte, sodass ich unfähig war, meiner Erkenntnis zu folgen.
Ich müsste etwas zeichnen, etwas schreiben, dann würde ich mich besser fühlen, mit mir selbst wieder vereint. Doch ich konnte es nicht. Nur unglücklich darüber sein, dass weder Wörter noch Striche zu mir kamen und ins Leben gebracht werden wollten.
So saß ich also an diesem Sonntagmorgen an meinem Fenster mit Blick hinaus in die graue Regenwelt und lernte: Samenruhe, Abscisin- und Gibberellinsäure, Stratifikation. Keimung.
Plötzlich schreckte ein dumpfer Knall neben meinem Kopf mich auf und ich sah noch ein paar braune Federn stieben, ehe etwas Dunkles meinem Sichtfeld entfiel. Ich sprang auf, so schnell die gestapelten Bücher auf meinem Schoß es erlaubten, und eilte die Wagentreppe hinab, in die Welt des Nieselregens, in der eine braun getupfte Drossel mit seltsam verdrehtem Kopf in meinem Blumenbeet lag. Ohne Nachdenken griff ich nach ihr, berührte die samtigen Federn.
Einmal zappelte der Vogel noch mit den Krallen, blinzelte, ehe er ganz still wurde, die Augen nur halb geschlossen. Als ich den warmen kleinen Körper in meine Hände nahm, kamen mir die Tränen.
Gerade war die Drossel noch übermütig umher geflogen, sehr schnell wohl der Wucht nach, mit der sie gegen meine Fensterscheibe geprallt war, voller Freude über die Kraft ihrer Flügel und den Schwung des raschen Fliegens. Und nun lag sie schlaff in meinen Händen. So schnell kann es gehen.
Gleichzeitig bezauberte mich die Anmut des Vogels, der lange Fiederschwanz, der im Leben sicher munter gewippt war, die gefalteten Flügel und zierlichen dunklen Krallen. Den Vogel auf den Händen lief ich in meinen Bauwagen zurück, bettete das Tier auf ein Zeitungsblatt und kniete mich mit Stift und Papier davor auf den Teppich. Fast war mir, als hätte mir die Drossel mit ihrem Tod vor meinem Fenster ein Geschenk gemacht.
Die Zeit für das Glück ist heute, nicht morgen!
Ich zeichnete die liebe Drossel, die mich so sehr anrührte und mir zugleich die Wahrheit der Vergänglichkeit vor Augen führte. Ich zeichnete sie, weil sie noch im Tod so schön war und weil ich diesen Augenblick nicht vergessen wollte.
Die Zeit für das Glück ist heute, nicht morgen.
Schon vor einer Woche stand dieser Spruch auf meinem Kalender, doch nur mein Kopf hatte ihn begriffen. Nun verstand auch mein Herz, mit einem Aufschluchzen und einem Lachen zugleich. Die Zeichnung floss nur so auf das Papier und mich ergriff das wunderbare Gefühl des Einklangs, das mich immer dann erfüllt, wenn die richtige Schöpfung zum richtigen Zeitpunkt geboren wird. Ein geschenktes Glück.
Noch einmal streichelte ich leicht über die weichen Brustfedern der Drossel, ehe ich sie an meiner Telekie begrub, die mit ihren gelben Blüten der hervor blitzenden Sonne zulächelte.
Rabe
Ich erwache zum Rauschen der Pappeln im Wind, diesem Brausen, das heimelig ist und beängstigend zugleich. Eine Stimme der Herbstwinde, die Blatt um Blatt von den Zweigen fegen.
Ach, ich wünschte so sehr, ich könnte länger im Bett liegen bleiben und lesen, warm und wohlig, an meinem Bauch eine schnurrende Katze. Doch die Zeit ist unerbittlich, der Hörsaal ruft. Ich erhebe mich mit dem Gähnen der Sonne und als ich mit dem Fahrrad dem Wind entgegen auf dem Feldweg fahre, errötet die Welt gerade im Sturmmorgenlicht, diesem unnachahmlichen Farbton, in dem alles irgendwie traumartig scheint.
Über mir ziehen Gruppen von Gänsen weiter nach Südwesten, fort von jenem Ort, zu dem ich nun auf dem Weg bin. Wie gern würde ich ihnen folgen! Fliegen, gleiten, vom Wind getragen, der mir unlieb Kälte ins Gesicht haucht, fort von den Verpflichtungen, frei und auf einer großen Reise.
Ich rufe zu ihnen empor: »Gute Reise! Grüßt mir den Süden!«
Eine Stimme antwortet mir, eine Stimme, die ich kenne, und schon sehe ich ihn als schwarzen Schatten über der Hecke. Größer erscheint er mir als die ziehenden Gänse, wie er durch die Böen tollt, sich trudelnd fallen lässt und mit geschicktem Flügelschlag abfängt, auf und ab, auf und ab, Kreisel und Salti. Er vollführt kühne Kapriolen, tanzt und spielt mit dem Sturm, während die Gänse weiter ins sichere Inland ziehen.
Als ich näher komme, lässt er sich auf einem Strommast nieder, wo er sich mir als stolzer Schattenriss präsentiert, sich ein wenig plustert und reckt und mir zuruft: »Krrok, krrok krrok!«
Keine Vogelstimme liebe ich so wie diesen hölzernen Ruf des Raben. »Guten Morgen, mein Freund«, werfe ich ihm meine Liebe in den Wind. »Du bis doch von allen der Schönste!«
»Krrok, krrok, krrok!«, gibt er mir seine Stimme mit auf den Weg.
Ja, ich will Rabe sein. Und wenn ich im Labor stehe, wenn ich keine Lust mehr habe und müde bin und nicht weiter weiß, werde ich lachen und dem Sturm zeigen, dass ich keine Angst vor ihm habe. Denn mein Leben gehört mir und ich lasse mich nicht beeindrucken, wenn ich es nicht will. Lieber bin ich frech, ein Schelm, mit einem hölzernen Ruf und glänzend nachtschwarzem Gefieder, an dem aller Regen abperlt.
Rabe will ich sein.
Die Göttin Flora
Sie trägt einen klangvollen Namen, und nicht nur einen. Flora. Demeter, vielleicht auch Freya. Brighid. Gaia.
Sie labt und mit ihren Farben und ihrer Frische, wenn sie im Frühjahr die ersten ihrer Geschöpfe zum Leben erweckt. Sie lässt die Pflanzen wachsen, die uns ernähren und ohne deren Tagesatem kein Leben möglich wäre auf der Erde. Die Bäume, die uns Schatten spenden, die Getreide, die wir essen, die farbenprächtigen Blüten, die wir bewundern: Sie alle sind ihre Kinder und ihre eigene Gestalt zugleich.
Sie ist steht hoch droben wie die höchsten Wipfel, dem Himmel ganz nahe, und schläft tief in der Erde mit den Wurzeln. Ihre Kleider sind grün wie das Blattwerk und ihr Haar ist ein einziges Blumenmeer. Sie funkelt und schillert wie die Blüten des Hahnenfuß und duftet lieblich wie Rosen und Jasmin.
Sie ist eine schöne Göttin, das steht außer Frage. Eine großzügige Göttin.
Doch sie kann auch anders sein.
Wenn das Jahr beginnt, laben wir uns an jedem Grün, an jeder Blüte, die nach der Winterkälte hervorkommt. Wir genießen die Pracht der Frühblüher, wenn sie in mystischen Teppichen die Waldböden und Wiesen bedecken. Wir loben ihre Grazie, wenn Tulpen und Narzissen und zu Ostern erfreuen und die Sträucher und Obstbäume blühen. Wir seufzen wonnig, wenn alle Bäume wieder ihr Laub tragen und die Welt grün und nur noch grün ist.
Dann aber wendet sich das Rad.
Noch immer lieben wir, wie die Finger der Flora Blüten über Nacht mit ihrem Zauber öffnen. Wenn die ersten Radieschen in unserem Garten wachsen und das Gemüse für den Sommer schön in den Beeten steht. Aber langsam, stetig, beginnt das Ringen mit der Göttin.
Ampfer, Giersch und Nesseln recken sich in die Höhe, bis sie uns stolpern lassen. Jedes Fleckchen der kostbaren Erde wird von Floras Gesandten erobert, bis die menschliche Gärtnerin den Kampf antritt und mit brennenden Armen, Nesselstichen überall, wieder erringt, was kein Nesselfeld werden sollte. Doch Flora schläft nie. Ihre Scharen sind zahlreich, schnell und lautlos. Die gerade befreite geliebte Blütenpflanze, der schmale Weg, der Platz zum Sitzen – es dauert nicht lang, schon stehen dort wiederum ihre Boten, unaufhaltsam und bewaffnet mit Dornen oder Gift. Eine grüne Flut.
Flora ist eine schöne Göttin, das steht außer Frage. Eine mächtige und großzügige Göttin.
Doch ihr Segen kann manchmal recht anstrengend sein.


